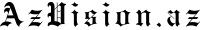"Coburg ist heute eine weltoffene Stadt im Herzen Europas, in der Menschen aus rund 140 Ländern miteinander leben", sagt Oberbürgermeister Dominik Sauerteig von der SPD. "Diese bunte Stadtgesellschaft macht für mich Coburg aus. Wir gehören zusammen. Die Vielfalt macht die Stadt stark, innovativ, liebens- und lebenswert. Die rechtsextremen Umtriebe in ganz Deutschland und ausländerfeindliche, antidemokratische und auch isolationistische Tendenzen in Politik und Bevölkerung besorgen mich zutiefst. Hier gilt es gegenzusteuern: Nie wieder ist jetzt!"
Sauerteig hat gelernt. Denn Coburg hat eine dunkle Geschichte, die lange verschwiegen wurde. "Der Name Coburg ist mehr als der Name irgendeiner Stadt", sagte Reichskanzler Adolf Hitler 1935. "Er ist mit einem epochalen Ereignis des Kampfes der nationalsozialistischen Bewegung verbunden. In diese Stadt sind wir mit einer Methodik, die wir später noch oft anwandten, zum ersten Mal gekommen und haben uns zum ersten Mal in dieser Stadt durchgesetzt.
Was Hitler damit meinte: In Coburg fing alles an. Die Nazis lernten in Coburg, ein ganzes Volk zu regieren, zu unterdrücken. Sie führten es in den Untergang. Am 8. Mai 1945 hatten sie ausregiert und hinterließen Deutschland als Trümmerfeld.
Wie alles anfing
Seit 1920 ist Coburg eine kleine Stadt im Nordosten Bayerns. Da schließt sich nach einem Volksentscheid der Freistaat Coburg an den Freistaat Bayern an. Neun Jahre später erreichen die Nationalsozialisten bei den Wahlen erstmals die Mehrheit in einer deutschen Stadt. Vier Jahre bevor die NSDAP ihr "Drittes Reich" errichtet.
Coburg ist eine schöne Stadt. Gotische Bauten schmücken das Zentrum, ein Renaissance-Rathaus. Wer über das Kopfsteinpflaster des Marktplatzes geht, fühlt sich in die Geschichte versetzt, wenn er das Wahrzeichen der Stadt bewundert: Albert, Großvater von Herzog Carl-Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha, dessen Statue 1865 enthüllt wird. Zu diesem Zweck besucht auch seine Gemahlin die Stadt, Königin Victoria von England. Auf den ersten Blick würde nichts an die braune Geschichte der Stadt erinnern, wären da nicht die Stolpersteine, die sich in einigen Bürgersteigen befinden.
Wer Coburg besucht, kommt an der Moritzkirche nicht vorbei, einer evangelischen Kirche, in der sogar Martin Luther gepredigt hat. 90 Prozent der Coburger sind in der Weimarer Republik evangelisch. Viele von ihnen besuchen die Kirche. Dort hören sie damals zum ersten Mal von der "Verjudung" der Gesellschaft, von "Fremdrassigen". Denn man pflegt in der Kirche einen "gesunden" Deutsch-Nationalismus, der donnernd von der Kanzel gepredigt wird. Dabei sind Juden in der oberfränkischen Stadt nur eine verschwindend kleine Minderheit: 1,2 Prozent der Bewohner gehören der jüdischen Religion an. Und dennoch sollen sie schuld sein. An allem. Den teuren Lebensmitteln während der Inflation 1923, der Weltwirtschaftskrise sechs Jahre später, der Arbeitslosigkeit. An allem.
Der "Coburger Blutsonnabend"
Coburg ist keine Arbeiterstadt im eigentlichen Sinne. Doch die SPD hat hier viele Anhänger, unterhält sogar eine eigene regionale Tageszeitung. Sie warnt vor Antisemitismus, hauptsächlich der Schriftleiter der Zeitung, Franz Klingler. Und sie kämpft für die neue, demokratische Weimarer Republik. So auch am 3. September 1921. Wenige Tage zuvor war der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger ermordet worden. Verantwortlich dafür: die "Organisation Konsul". Der Geheimbund hat enge Beziehungen zu Herzog Carl-Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha, der später ein enger Vertrauter und Förderer der Nationalsozialisten wird. An diesem 3. September 1921 entschließen sich Betriebsräte, Gewerkschafter und Sozialdemokraten, auf dem Coburger Schlossplatz "für die Republik und gegen den politischen Meuchelmord" zu demonstrieren.
Etwa 3000 Menschen kommen zusammen. Plötzlich tauchen Lastwagen auf. Die Türen öffnen sich. Mitglieder der bayerischen Landespolizei springen heraus, bewaffnet mit Maschinengewehren. Sie errichten Straßensperren. Die Demonstranten wehren sich. Handgranaten fliegen, Schüsse fallen. Die Demonstration wird aufgelöst. Bilanz des "Coburger Blutsonnabends": ein Toter, mehr als zwanzig Verletzte. Das war die erste Auseinandersetzung in Coburg, an der Menschen beteiligt waren, die sich gegen die Weimarer Republik wandten. Dieses Mal noch im Auftrag der Staatsregierung in Bayern. Die will Ruhe und Ordnung im Freistaat, auch mit der Hilfe von Völkischen und Nationalisten, wenn es nicht anders geht.
Gut ein Jahr später, am 14. Oktober 1922, hält ein Sonderzug auf dem Coburger Bahnhof. Etwa 650 Männer steigen aus, viele Schläger darunter, angeführt von einem kleinen, unscheinbaren Mann mit dunklen Haaren. Sein Name: Adolf Hitler. Die Männer sind eingeladen zum "Deutschen Tag", einer Veranstaltung des bayerischen "Schutz- und Trutzbundes", einer völkischen Vereinigung. Die Veranstaltung ist eigentlich verboten, doch der bayerische Freistaat duldet sie. Dort hält Hitler seine erste große Rede in der Öffentlichkeit.
Die ersten "Erfolge"
Es ist der erste Propagandaerfolg der damals noch unbedeutenden NSDAP. Zum ersten Mal tritt die SA in Aktion, die "Sturmabteilung" der Nazis, und liefert sich blutige Schlägereien mit linken Gegendemonstranten. Es ist das erste Mal, dass die NSDAP außerhalb von München aktiv wird. Die Polizei hält sich raus.
Es ist auch jener 14. Oktober 1922, an dem die erste Demonstration gegen einen Juden stattfindet. Es handelt sich um einen Großindustriellen, Eigentümer eines Metzgereibetriebes. Sein Name: Abraham Friedmann. Dreißig Nazis umstellen in der Nacht seine Villa, drohen ihm mit dem Tod. Friedmann versteckt sich. Er überlebt. Ein Streit zwischen ihm und dem NSDAP-Ortsgruppenleiter Franz Schwede wird 1929 zur Auflösung des Stadtrates und zu Neuwahlen führen. Die werden die Nationalsozialisten gewinnen. Friedmann selbst emigriert 1935 nach Paris, wo er drei Jahre später stirbt.
Nach dem "Deutschen Tag" 1922 steigt der Einfluss der NSDAP in Coburg schnell. Schon 1923 hat der NSDAP-Ortsverband 800 Mitglieder. Anschläge auf Juden und jüdische Einrichtungen häufen sich. Hier wird ein Ladenfenster eingeschlagen, dort sind es Fenster einer Synagoge. Die Betroffenen beschweren sich. Doch die Behörden, bis hin zur Regierung von Oberfranken, verhalten sich ruhig, nehmen die Anzeigen nicht ernst.
Die NSDAP regiert zum ersten Mal eine Stadt
Inzwischen ist auch Franz Schwede aktiv geworden. Er gründet den "Weckruf", eine NSDAP-Zeitung. Darin macht er Stimmung gegen Juden, Sozialdemokraten und andere, die ihm nicht passen. Er schreibt über "Geschäftsjuden" und ihre "unmoralischen Techtelmechtel mit dahergelaufenen Weibern", bildet Karikaturen von watschelnden Juden ab, kurz: Er sät Hass, wo er nur kann. Bei vielen Coburgern kommt das an. Vor allem der "Weckruf" ist es, der 1929 für den überwältigenden Wahlsieg der Nazis verantwortlich ist.
1932 ist es schließlich so weit: Mobbing, Kungeleien und einige Tricks der Nazis sorgen dafür, dass Franz Schwede Oberbürgermeister der Stadt Coburg wird. Die NSDAP regiert eine Stadt. Zum allerersten Mal. In Coburg beginnt das Dritte Reich. Ganz legal. Mit dem Wissen der Bevölkerung. Und mit ihrer Unterstützung.
Nun ändert sich das Leben in der Stadt, primär für Juden. Die Nazis verbieten, dass sie für das Schächten das städtische Schlachthaus benutzen dürfen. Öffentliche Aufträge werden nicht mehr an Juden vergeben. Die Bevölkerung wird aufgerufen, jüdische Geschäfte zu boykottieren. Doch nicht nur gegen sie richtet sich der Hass der Nazis. Franz Klingler, der Herausgeber der sozialdemokratischen Zeitung, wird mit dem Tod bedroht und mehrfach zusammengeschlagen. Bei der Stadt angestellte Sozialdemokraten werden entlassen. Im Gegensatz dazu bekommen SS-Führer Waffenscheine von der Coburger Stadtverwaltung. Oberbürgermeister Schwede lässt im Zentrum der Stadt eine "Prügelstube" einrichten, in der Gegner zu Tode gemartert werden. 1932 wird Hitler zum Ehrenbürger der Stadt ernannt.
Und heute?
"Das ist jetzt nur der Vorgeschmack", warnt ein NSDAP-Stadtrat. "In ein paar Jahren wird es noch ganz anders gehen." Er wird recht behalten, aber anders, als er es sich denkt. Die Nazis übernehmen die Macht im Deutschen Reich, führen es in den Untergang. Am 8. Mai 1945 ist alles vorbei. Franz Schwede, der erste Nazi-Oberbürgermeister in Deutschland, ist inzwischen Gauleiter in Pommern geworden. 1945 flieht er vor der Besetzung durch die sowjetische Armee zurück nach Coburg. Für die von ihm verübten Gräueltaten wird er zu zehn Jahren Haft verurteilt, von denen er fünf absitzt. Er stirbt 1960.
Und heute? Oberbürgermeister Dominik Sauerteig sagt: "Die Stadt Coburg geht mit ihrem dunklen Erbe sehr offen um. Erst kürzlich wurde eine akribische wissenschaftliche Untersuchung beendet und als Buch "Coburg voran!" herausgegeben, die das "Leben in der ersten nationalsozialistischen Stadt Deutschlands" und die Verflechtung der Coburgerinnen und Coburger mit dem Regime auf über 800 Seiten detailliert schildert. Das Buch wurde vom Coburger Stadtrat in Auftrag gegeben. Mehrere Straßen und Plätze wurden nach ehemaligen jüdischen Coburgern benannt.
Zudem entsteht derzeit ein Erinnerungsweg an jüdisches Leben mit 16 Stationen in der gesamten Innenstadt, der im Juli eröffnet wird. An der Eröffnung nehmen auch Nachkommen geflohener oder ermordeter jüdischer Coburger teil. "Zudem haben wir in Coburg inzwischen über 140 Stolpersteine, die an Opfer der hiesigen Nazi-Schergen erinnern. Jährlich folgen weitere. Und der 9. November ist ein wichtiger Tag im Kalender der Stadt. Jedes Jahr gibt es hier Gedenkversammlungen und Ansprachen."
Für Sauerteig ist der 8. Mai ein Tag der Befreiung. "Befreiung von einer menschenverachtenden Diktatur, Befreiung von einem mörderischen Unrechtsregime und letztlich auch eine langfristige Befreiung von faschistischem Gedankengut, das in den Köpfen vieler Coburgerinnen und Coburger verwurzelt war."
Quelle: ntv.de
Tags: