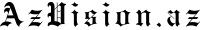Die Geschichte lehrt uns eines: Wenn es uns nicht gelingt, dieses Problem einzudämmen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich die Malaria auch in anderen Regionen ausbreitet. Besonders Afrika südlich der Sahara ist gefährdet, da dort die Belastung immer noch am höchsten ist. Sollte die Wirksamkeit der Erstbehandlung vor Ort heute gefährdet sein, wäre dies für ganz Afrika eine Katastrophe für die öffentliche Gesundheit.
Medikamentenresistenz – ein sich selbst verstärkender Prozess
Seit Jahren war unter Wissenschaftlern bekannt, dass die Resistenz gegen den Wirkstoff Artemisinin – der zuvor als sehr wirksames und rasch wirkendes Medikament gegen Malaria galt – ständig zunahm. Deshalb ging man zunächst dazu über, Artemisinin mit anderen gegen Malaria wirkenden Substanzen zu kombinieren. Dieses Vorgehen ist unter der Bezeichnung Artemisinin-Kombinationstherapie (ACT) bekannt. Die ACT wurde vor allem in Regionen angewandt, in denen weit verbreitet Artemisinin-Resistenzen aufgetreten waren (insbesondere in Südostasien).
Eines der bekanntesten Medikamente der ACT ist die Kombination aus Dihydroartemisinin und Piperaquin, die in Kambodscha seit 2008 bei der Erstbehandlung eingesetzt wurde und sich als eines der wenigen wirksamen Medikamente gegen viele kambodschanische Malaria-Stämme erwies.
»Die intensive Verbreitung der Artemisinin-Resistenz in Kambodscha droht nun immer mehr, die Wirksamkeit aller ACTs, die in dem Land und den Grenzregionen Vietnams, Thailands und von Laos eingesetzt werden, zu beeinträchtigen«, schreiben die Autoren der Studie.
Im Rahmen der Untersuchung wurden 204 Malaria-Patienten im Alter zwischen zwei und 65 Jahren in drei kambodschanischen Provinzen behandelt. Bei allen Erkrankten waren Stämme festgestellt worden, die zumindest teilweise gegen Artemisinin resistent waren. Nach der Behandlung mit Dihydroartemisinin-Piperaquin waren im Blut der Patienten zwar zunächst sehr schnell alle Parasiten abgetötet, jedoch wurden nach 63 Tagen in zahlreichen Fällen im Blut erneut Parasiten nachgewiesen, und zwar bei 1,67 Prozent der Patienten in der Provinz Rarankiri, bei 15,9 Prozent in der Provinz Preah Vihear und bei 45,7 Prozent in Pursat. Vor allem in Gebieten, in denen die Artemisinin-Resistenz besonders stark ist, kam es am häufigsten zum erneuten Auftreten der Parasiten.
Laboruntersuchungen bestätigten, dass die Malaria-Parasiten im Blut der Patienten, bei denen die Parasiten nach der Erstbehandlung wieder aufgetreten waren, tatsächlich gegen Artemisinin resistent waren. Aber sie reagierten anfällig auf den Wirkstoff Mefloquin. Daher schlugen die Forscher vor, bei der Erstbehandlung in diesen Regionen ein Kombinationspräparat aus Artesunat (einem mit Artemisinin eng verwandten Wirkstoff) und Mefloquin einzusetzen.
Entwicklung kaum noch einzudämmen
Die Wissenschaftler machen eine übermäßige Abgabe von Dihydroartemisinin-Piperaquin durch private Arzneimittelhändler für die Ausbreitung der Piperaquin-Resistenz verantwortlich. Diese Händler verkaufen den Leuten, die ihre Malaria-Erkrankung ohne einen Arztbesuch behandeln wollen, die eigentlich verschreibungspflichtigen Medikamente.
»Jetzt sind intensive Bemühungen erforderlich, um dieser offenbar sehr ineffektiven Herangehensweise der Selbstbehandlung im Privatsektor entgegenzuwirken und von ihr abzuraten«, heißt es in der Studie weiter.
Die Forscher warnen: Sollte sich der multiresistente Stamm ausbreiten, hätte dies weltweit verheerende Folgen. Eine ähnlich katastrophale Entwicklung war schon einmal in den 1950er-Jahren in Kambodscha aufgetreten, nachdem Chloroquin-resistente Erreger zunächst in Kambodscha aufgetaucht waren und sich dann weltweit verbreiteten.
»Da nur wenige andere ACTs verfügbar sind und weil eine Artemisinin-Resistenz vermutlich die Entwicklung von Resistenzen gegen die anderen Wirkstoffe des Kombinationspräparats beschleunigt, sind Forschungen zur Entwicklung alternativer Behandlungsansätze dringend erforderlich«, so die Wissenschaftler.
Leider könnten sich wirkstoffresistente Stämme so rasch entwickeln, dass eine Eindämmung lediglich ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit verringern könnte. Bereits 2013 stellte die WHO fest, dass die Bemühungen, eine Verbreitung gegen Artemisinin-resistente Malaria-Stämme in Kambodscha zwar offenbar erfolgreich seien, in Thailand, Burma und Vietnam aber unabhängig davon Artemisinin-Resistenzen aufgetaucht seien.
Im gleichen Jahr kündigte die WHO an, in Südwestasien auf drei Jahre angesetzte Bemühungen zur Bekämpfung von Malaria-Resistenzen mit einem finanziellen Umfang von 400 Millionen Dollar zu starten. Die neue Untersuchung legt nahe, dass diese Bemühungen weitgehend gescheitert sind.
Tags: