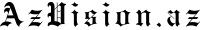Groß war das Entsetzen, als vor etwa vier Jahren immer deutlicher wurde, dass SARS-CoV-2 die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit weit über die akute Infektion hinaus einschränken kann. Längst hat das Phänomen länger als vier Wochen andauernder Symptome mit Long Covid einen Namen bekommen - von ursächlicher Heilung solcher Langzeitfolgen ist die Medizin aber weit entfernt.
Unklar sind weiter auch die genauen Ursachen - Theorien allerdings gibt es viele. Sicher bestätigt sei bisher keine Hypothese, sagt Winfried Kern von der Universität Freiburg. Das erschwere die Suche nach Behandlungsansätzen.
Das Risiko ist deutlich gesunken
Eine gute Nachricht wiederum ist: Im Zuge von mehr Immunschutz durch Impfungen und durchgemachte Infektionen sowie weniger aggressiver Virusvarianten hat sich das Risiko, nach einer Erkrankung Long Covid zu entwickeln, deutlich vermindert. Ergebnissen der "Virus Watch"-Studie des University College London zufolge weisen die jüngeren Omikron-Untervarianten ähnliche Wahrscheinlichkeiten für Langzeitsymptome auf wie andere akute Atemwegserkrankungen. Omikron ist die seit Anfang 2022 weltweit dominierende Corona-Variante.
In der ersten Infektionswelle der Pandemie habe das Risiko für mehr als zwölf Wochen andauernde Beschwerden - Post Covid genannt - bei etwa sechs bis acht Prozent gelegen, sagt Andreas Stallmach vom Universitätsklinikum Jena (UKJ). Inzwischen seien es wahrscheinlich etwa ein bis zwei Prozent. Das heißt: Etwa ein Mensch von hundert, der sich mit Corona infiziert und Symptome entwickelt, hat anschließend länger als drei Monate andauernde Beschwerden.
Je länger die Symptome, desto schlechter die Prognose
"Der Anteil derer, bei denen sie innerhalb eines halben Jahres wieder verschwinden, ist recht hoch", sagt Carmen Scheibenbogen von der Charité Berlin. Kritisch wird es danach: "Wer nach einem halben Jahr noch Symptome hat, hat sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nach ein oder zwei Jahren noch." Und die Chancen auf Genesung schwinden weiter: "Je länger man krank ist, desto weniger wahrscheinlich wird es, dass man noch gesund wird", erklärt der Freiburger Forscher Kern.
Doch was entscheidet darüber, ob man Long Covid entwickelt - und ob es langfristig bleibt? Bekannt ist, dass Frauen zwei Drittel der Long-Covid-Betroffenen stellen und ein großer Teil der Patienten vergleichsweise jung ist - bei beiden Faktoren spielt das aktivere Immunsystem eine Rolle, wie Scheibenbogen erklärt. Unter anderem Übergewicht und Erkrankungen des Immunsystems vergrößern das Risiko.
Kaum komplette Heilung bei Betroffenen
Das bestätigt die im Fachjournal "PLOS Medicine" vorgestellte Studie eines Teams um Kern zu rund 1.000 Erwachsenen mit Post-Covid-Syndrom aus der ersten Ansteckungswelle. Etwa zwei Drittel hatten mehr als ein Jahr lang Symptome, die sich im zweiten Jahr nicht wesentlich verbesserten. Bei knapp einem Drittel schwanden die Beschwerden, nur bei einem kleinen Teil aber komplett.
Es handelte sich um Menschen, die zwischen Oktober 2020 und April 2021 positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, als überwiegend der Wildtyp und teils auch schon die Alpha-Variante kursierten. Die Teilnehmenden unterzogen sich im Südwesten Deutschlands Tests zur körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit, zudem wurden zahlreiche Blut- und sonstigen Werte gemessen.
Risikofaktoren: Rauchen, Übergewicht - und niedriger Bildungsstatus
Menschen mit länger anhaltendem Post Covid hatten der Auswertung zufolge seltener als solche mit wieder verschwindenden Beschwerden nie geraucht (61,2 versus 75,7 Prozent), waren häufiger fettleibig (30,2 versus 12,4 Prozent) und hatten einen niedrigeren Bildungsstatus (Hochschulreife 38,7 versus 61,5 Prozent). Ein Zusammenhang zeigte sich auch beim Schweregrad der Symptome während der akuten Infektion sowie dem Beschäftigungsstatus: Bei anfangs vollzeitbeschäftigten Menschen und solchen mit schwächerer Erkrankung war die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Symptome wieder schwanden.
Wer zuvor vollzeitbeschäftigt arbeitete und eine Familie zu versorgen hat, sei im Mittel womöglich tatkräftiger dabei, wieder aus der Situation wegzukommen, vermutet Kern. "Das eigene Engagement spielt eine große Rolle", betont der Mediziner. "Man muss den festen Willen haben, konsequent dranzubleiben."
Was dem Zusammenhang mit dem Bildungsstatus zugrunde liegt, lasse sich nicht gesichert sagen. Ein möglicher Faktor sei, dass Menschen mit höherem Bildungsstatus eher gezielt Hilfe suchten und eher in der Lage seien, die Zeit für umfangreiche Therapien und Trainingseinheiten aufzubringen.
Gesundheit hängt in Deutschland vom Einkommen ab
Stallmach ergänzt eine weitere potenzielle Ursache: "Gesundheit hängt in Deutschland vom Einkommen ab", betont er. "Menschen mit geringem Einkommen haben eine deutlich schlechtere Grundgesundheit." Infektionen können bei ihnen darum schlimmere Folgen haben. Ein denkbarer Faktor sei auch, dass besser Gebildete durch mehr Wissen differenzierter auf Symptome blicken und sie seltener auf eine zurückliegende Corona-Infektion zurückführen, ergänzt Kern.
Denn ein Grundübel bei der Diagnose besteht nach wie vor: Es gibt - anders als etwa bei Fieber oder Bluthochdruck - keinen leicht zu bestimmenden Wert, keinen einzelnen Marker, an dem sich Long Covid festmachen ließe. Das zeigte auch die Studie des Teams um Kern mit vielen verschiedenen Tests und Messungen. Daher bleibt eine Diagnose häufig lange vage, langwierige Abklärungen sind nötig.
"Viele Symptome lassen sich unterschiedlich bewerten - zudem kann aus dem Verdacht auf Long Covid eine ganz andere Diagnose werden", sagt Stallmach, Leiter des Post-Covid-Zentrums am UKJ. Sowohl für Patienten als auch Ärzte sei es wichtig, ihren Blick entsprechend zu weiten. Verzerrend kann Kern zufolge gerade bei Senioren zudem wirken, dass eine altersbedingte Verschlechterung körperlicher und geistiger Fähigkeiten als vermeintliche Covid-Langzeitfolge empfunden wird.
Müdigkeit und Erschöpfung sind häufige Symptome
An den häufigsten Symptomen von Long Covid hat sich seit Beginn der Pandemie wenig verändert. Bei der Studie des Teams um Kern zählten zu den angegebenen Beschwerden vorherrschend Müdigkeit und Erschöpfung, kognitive Störungen wie Konzentrations- oder Gedächtnisschwäche, Schmerzen im Brustkorb, Atemnot sowie Angst, Depressionen und Schlafprobleme. Bei Menschen mit länger anhaltendem Post-Covid-Syndrom berichtete mehr als ein Drittel, weniger belastbar bei Anstrengungen zu sein. Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns spielten fast nur während der akuten Infektion eine Rolle, kaum als Langzeitfolge.
Die wohl gefürchtetste Ausprägung bei Post Covid ist ME/CFS - Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom. Ein Großteil der Langzeit-Post-Covid-Fälle gehe darauf zurück, bundesweit seien aktuell geschätzt etwa 150.000 bis 200.000 Menschen betroffen, erklärt Stallmach. Hinzu kommen zahlreiche Patienten, die ME/CFS unabhängig von einer Corona-Infektion entwickeln.
Eingeschränkt bis zur Pflegebedürftigkeit
ME/CFS ist eine komplexe Erkrankung, die unter anderem von bleierner körperlicher Schwäche und äußerst geringer Belastbarkeit geprägt ist. Typisch ist eine deutliche Verstärkung der Beschwerden schon nach geringer körperlicher oder geistiger Belastung. Viele Betroffene sind arbeitsunfähig und können sich kaum selbst versorgen, einige verlassen kaum noch das Bett, sind zu 100 Prozent pflegebedürftig. Meist wird die Erkrankung durch einen Infekt ausgelöst, oft chronifiziert sie - bleibt also dauerhaft bestehen.
Beim Alter der Patienten gebe es eine große Bandbreite - schon 20-Jährige könnten betroffen sein, sagt Stallmach. "Manche sind so schwer krank, dass sie ihr vorheriges Leben komplett verloren haben." Auch in diesem Bereich sei bisher keine überzeugende Therapie gefunden. "Ich bin aber optimistisch, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird."
Kein großes Interesse bei Konzernen
Weniger optimistisch beurteilen Experten das Engagement von Pharmafirmen im Long-Covid-Bereich. Konzerne schrecke ab, dass es gegen ein so komplexes Leiden vermutlich nicht das eine, gegen alles wirkende Medikament geben werde. Hinzu komme das Problem der schwierigen Bewertung: "Wenn es keinen leicht messbaren Marker gibt, sondern Betroffene zum Beispiel nur in Selbstauskunft angeben können, dass sie sich jetzt 10 Prozent weniger müde fühlen, ist das ganz schlecht für eine Zulassungsstudie", erklärt Kern.
Es gebe erste angelaufene Studien an Patienten unter anderem in den USA und an der Charité, sagt Scheibenbogen, die das Charité Fatigue Centrum leitet und auf die Erforschung und Behandlung von ME/CFS spezialisiert ist.
Prävention ist ein zentraler Ansatzpunkt
Wichtig sei aber, nicht nur Therapien gegen Langzeit-Post-Covid zu entwickeln, sondern sich auch mit Prävention zu beschäftigen: "Wie lässt sich gezielt verhindern, dass sich nach einer Infektion Long Covid entwickelt?" Metformin sei ein aussichtsreicher Kandidat dafür, ebenso wie histaminhaltige Nasensprays. Nützen dürfte das Risikopatienten nicht nur bei Corona, sondern auch bei anderen Infektionen.
Denn auch wenn Long Covid vielen als etwas Neues erschien: Das Phänomen andauernder Nachwirkungen im Nachgang von Infektionen kennen Ärzte schon seit mehr als einem Jahrhundert - durch die immens hohen Fallzahlen während der Pandemie wurde nur plötzlich ein Fokus darauf gerichtet.
Zahl der Betroffenen schwer zu schätzen
Wie viele Menschen in Deutschland aktuell von Long Covid oder Post Covid betroffen sind, lässt sich nur grob schätzen. Fachleute wie Kern gehen von einer sechsstelligen Zahl an Post-Covid-Patienten aus.
Derzeit fielen Patienten oft irgendwann aus dem Raster, sagt Stallmach. Nach etwa zwei Jahren gehe es in Richtung Frühverrentung, danach würden viele Betroffene quasi aufgegeben und verlören auch selbst die Hoffnung auf Genesung und ein normales Leben. "Das kann nicht sein, zu sagen: Dann ist es eben so. Wir dürfen das nicht akzeptieren, wir dürfen diese Patienten nicht vergessen."
Quelle: ntv.de, Annett Stein, dpa
Tags: