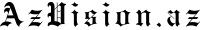In der EU herrscht ein Machtkampf um das für 2035 geplante Verbrenner-Aus. Aus Sicht von Branchenexperten würde eine Rücknahme des Verbots der deutschen Autoindustrie insgesamt jedoch mehr schaden als nutzen.
Müssten die Hersteller zweigleisig fahren, also sowohl auf E-Autos als auch weiterhin auf neue Verbrenner setzen, würden doppelte Entwicklungskosten und zusätzliche Strukturen anfallen. Außerdem könnte sich der Rückstand zu chinesischen Elektroauto-Herstellern vergrößern, warnt Frank Schwope im Gespräch mit ntv.de. "Das wäre eine zusätzliche Belastung", sagt der Lehrbeauftragte für Automobilwirtschaft an der Fachhochschule des Mittelstands Hannover. "Und noch mehr Unsicherheit für die Autoindustrie."
Nach bisherigem Stand sollen ab 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr neu zugelassen werden, bis dahin werden stufenweise die CO2-Vorgaben verschärft. Die EU-Kommission hat bereits eine Lockerung der CO2-Werte vorgeschlagen. Die neuen Flottengrenzwerte sollen demnach nicht mehr in diesem Jahr erreicht werden müssen, sondern nur im Durchschnitt der drei Jahre 2025 bis 2027. Beim Verfehlen der Vorgaben drohen den Autobauern hohe Strafzahlungen. Diese würden mit der Lockerung vorerst vermieden.
Das Europaparlament und die 27 EU-Staaten müssen über diese Lockerungsvorschläge nun verhandeln. Die Verhandlungsführer könnten weitere Änderungen an den Grenzwerten und sogar am Verbrenner-Aus für 2035 einbringen. Die CDU beispielsweise will das Verbot kippen.
Planungssicherheit versus Gnadenfrist
Branchenkenner Stefan Bratzel ist gegen eine Rücknahme des Verbrenner-Verbots und pocht stattdessen auf Planungssicherheit. "Sonst glaubt irgendwann keiner mehr, dass man sich auf politische Vereinbarungen verlassen kann", sagt der Leiter des Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach im Gespräch mit ntv.de. Auch wenn er selbst kein großer Freund des harten Verbots sei, weil es stark emotionalisiert habe, sollte seiner Meinung nach jetzt daran festgehalten werden. Andernfalls würde das Vertrauen in die Politik noch stärker belastet als ohnehin schon.
Selbst Industrievertreter hatten von der Politik Planungssicherheit statt einer Rolle rückwärts gefordert. "Die Autoindustrie ist langzyklisch, wir können nicht alle drei, vier Jahre unsere Entscheidungen infrage stellen", sagte etwa VW-Chef Oliver Blume vor einem Jahr. Dass die EU der Forderung nach einem Aus des Verbrenner-Aus nun trotzdem nachkommen könnte, erklärt sich Schwope mit einer gewissen Spaltung der Branche. Während einige Hersteller bei E-Autos bereits stark sind, hinken andere hinterher.
Gut möglich, dass die EU außerdem Zulieferern entgegenkommen will. "Sehr viele hängen noch am Verbrenner, leiden jetzt schon und bekommen in den nächsten Jahren massive Probleme, wenn es nur in Richtung Elektromobilität geht", so Schwope.
Trump vergrößert die Probleme der Branche
Die Autobauer, die mit ihren E-Autos noch hinterherfahren, würde ein weiteres Aufweichen der CO2-Vorgaben finanziell entlasten. Denn dann müssten sie ihre elektrischen Modelle nicht so günstig anbieten, dass sie entsprechend viele davon verkaufen, um die Vorgaben einzuhalten. Die "riesigen Herausforderungen" der Branche seien durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump noch größer geworden, gibt Bratzel zu bedenken. Der internationale Wettbewerbsdruck habe sich wesentlich verschärft. Deshalb schraube die EU nun an ihren Klimazielen.
Doch würde das geplante Ende neuer Verbrenner gekippt, würden die Unternehmen benachteiligt, die bereits stark auf die Elektromobilität setzen. Während des "Spiels" die Regeln zu ändern, wäre in Schwopes Augen unfair. Allerdings wäre es auch seiner Meinung nach sinnvoller, wenn Autobauer die drohenden Strafzahlungen stattdessen für Investitionen nutzen könnten. "Zusätzliche Belastungen für die Hersteller müssen nun wirklich nicht sein."
Das Verbrenner-Aus hält der Branchenkenner aber für machbar. "Bis zum Jahr 2035 sind es ja immerhin noch zehn Jahre." Schwope stellt klar: "Langfristig führt nichts am Elektromotor vorbei, und bei der Batterietechnologie gibt es immer noch große Fortschritte." Schon jetzt seien chinesische Hersteller dabei weit voraus, insbesondere in der Batterieforschung. "Da muss man massiv aufholen." E-Fuels werden bei Pkws in den nächsten 10 bis 15 Jahren keine Rolle spielen, wie Bratzel erklärt. "Der energetische Wirkungsgrad ist so viel schlechter, dass entsprechende Investitionen Milliarden kosten würden, die man refinanzieren müsste."
"Wir können uns nicht mehr Zeit lassen"
Um bei Elektroautos aufzuholen, empfiehlt Bratzel, vor allem auf eine bessere Ladeinfrastruktur und Innovationen in der Batteriezelltechnologie zu setzen. "Da haben wir riesigen Aufholbedarf, und mit Northvolt fällt jetzt auch noch ein zentraler Akteur weg." Die Politik müsse die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Diese wären in den Augen des Branchenexperten sinnvoller als eine neue Kaufprämie, wie sie etwa die SPD fordert.
Auf den Technologiewandel würde sich eine Rücknahme des Verbrenner-Verbots nach Bratzels Einschätzung gar nicht dramatisch auswirken. "Die Elektromobilität wird sich, auch aus Kostengründen, ohnehin durchsetzen." Das "elektromobile Ökosystem" werde sich in zehn Jahren so weit entwickelt haben, dass es große Vorteile bringe, beispielsweise durch bidirektionales Laden.
Doch würden die CO2-Vorgaben weiter entschärft, etwa die Flottengrenzwerte für das Jahr 2030, könnte der Klimaschutz zunehmend infrage gestellt werden, warnt der Autoexperte. Der Hochlauf der Elektromobilität in Europa könnte dadurch weiter verlangsamt werden - bis hin zum "Eigentor" bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. "Eine meiner größten Sorgen ist, dass das Gefühl entsteht, wir könnten uns doch ein bisschen mehr Zeit lassen", sagt Bratzel. "Das können wir nicht." In China stünden die Zeichen ganz auf Elektromobilität, die europäischen Hersteller müssten durch eine hohe Zahl an E-Neuzulassungen Skalierungseffekte schaffen.
Um das zu erreichen, wäre es seiner Ansicht nach sinnvoller gewesen, die CO2-Grenzwerte nicht in Stufen alle fünf Jahre zu verschärfen, sondern jedes Jahr. In den vergangenen Jahren habe sich gezeigt: "Die Hersteller unternehmen erst dann etwas, wenn es wirklich notwendig ist."
Quelle: ntv.de
Tags: