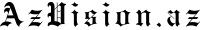Der Urvogel Archaeopteryx lebte vor etwa 150 Millionen Jahren als frühester bislang bekannter Vogel - und alle 14 bislang bekannten Exemplare wurden in der Umgebung des bayerischen Solnhofen in der Fränkischen Alb entdeckt. Eine Analyse des bislang kleinsten und gleichzeitig anscheinend besterhaltenen Archaeopteryx im Fachblatt "Nature" liefert nun teils überraschende Befunde.
Das Exemplar, das jahrzehntelang in Privatbesitz war, wurde 2022 vom Field Museum in Chicago aufgekauft, präpariert und analysiert. Mit Ausnahme eines einzelnen Fingers ist es vollständig. "Unser Exemplar ist so gut erhalten und so gut präpariert, dass wir tonnenweise neue Informationen erhalten, von der Spitze des Schnabels bis zum Schwanzende", sagt Erstautor Jingmai O'Connor.
Untersucht wurde das Fossil des etwa taubengroßen Vogels per Mikro-Computertomografie mit UV-Licht, um Weichgewebe sichtbar zu machen. Die Analyse zeigt erstmals, dass der Urvogel nicht nur, wie bereits bekannt, über Hand- und Armschwingen - auch Primär- und Sekundärfedern genannt - sowie Schulterfedern verfügte, sondern auch über sogenannte Tertiärfedern, die heutigen Schirmfedern ähneln. Die Tertiärfedern gehen von den beiden Ellbogen fächerförmig ab und lagen beim Fliegen am Rumpf des Tieres an.
"Sehr langer Oberarmknochen"
"Im Vergleich zu den meisten lebenden Vögeln hatte Archaeopteryx einen sehr langen Oberarmknochen", erläutert O'Connor. "Und wenn man fliegen will, kann dies zu einer Lücke führen zwischen den langen Primär- und Sekundärfedern des Flügels und dem Rest des Körpers. Wenn Luft durch diese Kluft strömt, stört das den Auftrieb und verhindert das Fliegen."
Diese Lücke schließen Vögel mit Schirmfedern. Bei dem nun vorgestellten Archaeopteryx könne man derartige Federn, deren Existenz bislang umstritten war, erstmals sehen. "Diese Federn fehlen bei gefiederten Dinosauriern, die mit Vögeln zwar eng verwandt sind, aber eben doch keine Vögel sind", folgert O'Connor. "Ihre Flügelfedern hören am Ellbogen auf." Im Gegensatz zu diesen Dinosauriern, so der Autor, konnte der Archaeopteryx tatsächlich fliegen.
Dienten Federn der Kommunikation?
Möglicherweise hatten diese Federn noch weitere Funktionen, mutmaßt das Team - denn sie nehmen im Vergleich zum Gefieder heutiger Vögel sehr viel Fläche ein. Eventuell, so spekulieren die Forscher, spielten diese Federn auch eine Rolle bei der visuellen Kommunikation der Tiere.
Und auch wenn der Urvogel auffällige Flügel hatte: Die Analysen der Extremitäten des "Chicago Archaeopteryx" zeigen Polster an den Zehen. Dies deute darauf hin, dass der Urvogel auch Zeit am Boden verbrachte und möglicherweise sogar in Bäumen kletterte - ähnlich, so notiert das Team, wie heutige Tauben. Das deute auf einen "gemischt terrestrischen und baumbezogenen Lebensraum für diesen frühen fliegenden Vogel hin", heißt es.
Weitere Resultate: Der kleine Finger an der Hand der Tiere war offenbar frei beweglich. Und der Schwanz war länger als gedacht: Bisher waren nur 22 Schwanzwirbel des Archaeopteryx bekannt. Bei dem nun vorgestellten Tier sind es 24.
Quelle: ntv.de, Walter Willems, dpa
Tags: