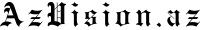Während Spanien und Portugal nach dem historischen Stromausfall zur Normalität zurückkehren, hält die Suche nach den Ursachen an. Der spanische Netzbetreiber Red Eléctrica machte eine abrupte Unterbrechung der Stromverbindung mit Frankreich für den Zusammenbruch verantwortlich. Warum es zu dieser Entkopplung kam, blieb allerdings vorerst offen.
Der spanische Experte Simón Martín, Professor am Fachbereich Elektrotechnik der Universität León, führt den massiven Stromausfall auf zwei Probleme der spanischen Stromversorgung zurück:
Problem Nummer 1: Schlechte internationale Anbindung
Eine Schwachstelle des spanischen Stromnetzes sei schon immer die begrenzte internationale Vernetzung gewesen, so Martín. Diese sei durch die geografische Barriere der Pyrenäen bedingt. Spanien kann mit der grenzüberschreitenden Vernetzung laut Martín nur rund drei Prozent seiner Kraftwerksleistung abdecken - das in der Energie- und Klimaschutzpolitik der EU für 2030 festgelegte Ziel liege jedoch bei 15 Prozent. Und je weniger Vernetzung, desto weniger Möglichkeiten, Überschüsse und Mängel im Stromnetz auszugleichen. Das ist wichtig, denn in Stromnetzen müssen Produktion und Verbrauch sich jederzeit exakt austarieren. Geschieht das nicht, droht ein Blackout.
Problem Nummer 2: Hoher Anteil an erneuerbaren Energien
"Die Energiewende hin zu erneuerbaren Energiequellen verändert das Erzeugungsprofil in Spanien grundlegend", so Martín. Zuletzt hätten erneuerbare Energien bereits zwei Drittel der installierten Kapazität ausgemacht und 60 Prozent der erzeugten Elektrizität produziert. Wind- und Solarkraft seien in Spanien die wichtigsten erneuerbaren Technologien, gefolgt von Wasserkraft. Doch sie hätten einen Nachteil, so Martín: Sie bieten keinen Puffer, wenn es zu Schwankungen im Netz kommt. Anders bei mit Wärme betriebenen Kraftwerken, in denen Turbinen in ihrer Drehung Energie speichern und somit als Puffer dienen und Schwankungen ausgleichen können.
Spanisches Netz anfällig
Durch die geringe Verbindung an internationale Netze und den hohen Anteil erneuerbarer Energien sei das spanische Netz daher anfälliger geworden, so Martín. Er vermutet, dass eine Abfolge von unglücklichen Umständen schließlich den Stromausfall am 28. April zur Folge hatte.
Ein Zusammenhang besteht laut Martín möglicherweise mit einer Störung im französischen Stromnetz, welche eine plötzliche Abschaltung der Hochspannungsleitung zwischen Frankreich und Spanien zur Folge hatte. Dies wiederum könnte die Instabilität des spanischen Systems erhöht haben, das anders als jenes in Frankreich geringer mit anderen Ländern vernetzt sei. Experten sprechen mit Blick auf die fast isolierte iberische Halbinsel auch von einer "Strominsel". Zudem komme der Strom in Frankreich zu einem großen Teil aus Kernkraftwerken, so Martín, in denen rotierende Teile in den Generatoren Energie speichern und Schwankungen im Netz ausgleichen können.
Die genannten Probleme traten dann auch noch zu einem Zeitpunkt auf, an dem für Schwankungen ohnehin anfällige Solar- und Windkraftwerke in Spanien einen Großteil des Stroms bereitstellten: "Um 12 Uhr mittags am Tag des Stromausfalls sollten 73 Prozent des prognostizierten Bedarfs durch Solarenergie und nur 3,3 Prozent durch Windenergie gedeckt werden, was die Anfälligkeit für Spannungsschwankungen erhöhte", so Martín. Der aus diesen Umständen resultierende Spannungsabfall im spanischen Netz könnte dann zu einer Entkopplung von Solar- und Windkraftanlagen geführt haben, was möglicherweise den Zusammenbruch des Systems begünstigte.
Mehr Speicher und Mikronetze
"Wenn sich diese Hypothese bestätigt, ist es unwahrscheinlich, dass sich das Ereignis kurz- bis mittelfristig wiederholt", gibt der Experte jedoch Entwarnung. Die Stromflüsse könnten nun auf alternative Leitungen umgeleitet werden. Dennoch bleibe die Gefahr bestehen und eine einfache Lösung sei nicht zur Hand. Allerdings würde bereits an einer neuen 5000-Megawatt-Verbindung zwischen Spanien und Frankreich gearbeitet, die Ende 2027 einsatzbereit sein und die Austauschkapazität nahezu verdoppeln soll.
Weitere denkbare Sicherheitsmaßnahmen seien der Einsatz von mehr Energiespeichersystemen und die Entwicklung von Mikronetzen, die sich im Falle eines Ausfalls vom Hauptnetz isolieren und durch dezentrale Erzeugung aus Solaranlagen, Kleinwindkraft, Kraft-Wärme-Kopplung und Batterien selbst versorgen könnten. "Diese Lösungen werden die Flexibilität und Widerstandsfähigkeit des Netzes erhöhen, erfordern jedoch noch eine größere technologische Reife und eine starke regulatorische Unterstützung", so der Experte.
Quelle: ntv.de, kst
Tags: