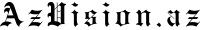Sicher, inzwischen gibt es Partnerbörsen im Internet. Aber wenn zwei Menschen sich kennenlernen, sitzt auch heute noch meistens ein stiller Vermittler dazwischen: das Getränk. Ob Kaffee, Tee, Wein oder Bier – in vielen Situationen klammern sich Menschen an ihre Tasse oder das Glas, als würde ihnen ohne die Flüssigkeit im Gespräch die Stimme versagen.
Wollen wir uns nachher auf einen Kaffee treffen? Kommst du mit auf ein Feierabendbier? Mögt ihr ein Glas Wein? Die Einladung ist mehr als nur Small Talk. Vor allem Alkohol dient seit jeher als Treibstoff zwischenmenschlicher Beziehungen. "Der Wein enthüllt Verborgenes", sagte der griechische Philosoph Eratosthenes im 3. Jahrhundert vor Christus. So veranstalteten die Griechen große Festgelage und schöpften beim symposion (altgriechisch für "gemeinsames Trinken") Wein aus einem großen Kessel. Die Sumerer in Mesopotamien und die alten Ägypter betrachteten das Bier als Göttertrank und schlürften es gemeinschaftlich mit Strohhalmen aus einem Tonkrug.
Wir synchronisieren unseren Trinkrhytmus
Heute wird die verbindende Wirkung der Getränke streng wissenschaftlich untersucht, von Soziologen, Psychologen, Anthropologen, Ethnologen, Ökonomen. Beispiel Alkohol: Amerikanische Forscher studierten das Gesprächsverhalten von 720 Teilnehmern, die in Vierergruppen unterschiedliche Drinks konsumieren und sich dabei unterhalten sollten. Diejenigen, die ein alkoholisches Getränk bekamen, redeten mehr miteinander und lächelten sich häufiger an – die Forscher sprechen von "goldenen Momenten" – als die Vergleichsgruppen mit alkoholfreien Drinks. Eine niederländische Studie zeigt, dass Menschen sogar ihren Trinkrhythmus synchronisieren: Nippte der Versuchsleiter in der Forschungsbar am Glas, tat es sein Gegenüber ihm gleich, mit Wein und Bier häufiger als mit Wasser und Softdrinks.
In größeren Gruppen bringt Alkohol Menschen in vielen Kulturen dazu, merkwürdige Rituale auszuführen (zuprosten, Trinksprüche aufsagen, Schnapsflaschen auf den Tresen klopfen). Der Anthropologe Victor Turner unterteilte solche Formen symbolischer Handlungen in drei Stufen. Erstens: Eine Gruppe wird aus den Alltagsstrukturen gelöst. Zweitens: Die Teilnehmer erleben gemeinsam eine Situation, in der Hierarchien und soziale Regeln aufgebrochen werden, während die Gruppe zu einer Einheit verschmilzt. Drittens: Die Gruppenmitglieder kehren zurück in den Alltag. Gut möglich, dass die Rangordnung am Morgen nach dem Saufgelage eine andere ist.
Auch nichtalkoholische Getränke haben eine soziale Funktion. Während der Aufklärung dienten Europas Kaffeehäuser als Nachrichtenbörse für Wissenschaftler, Kaufleute, Politiker, Anwälte. Hier wurden Geschäfte gemacht. Heute richten Firmen Kaffeeecken und Teeküchen ein. Die Angestellten sollen sich wohlfühlen, Wissen austauschen – und am Ende produktiver sein. Eine dänische Studie zeigte, dass Angestellte den gemeinsamen Kaffee mehr als das Mittagessen dazu nutzen, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Es ist Spekulation, aber nicht ausgeschlossen, dass heiße Getränke einem positiven Arbeitsklima förderlich sind. Versuchsteilnehmer, die einen Kaffee in der Hand hielten, ordneten einer fiktiven Person, von der sie eine kurze schriftliche Beschreibung erhielten, warme Persönlichkeitseigenschaften zu (großherzig, freundlich, fürsorglich, vertrauenswürdig). Diejenigen hingegen, die einen Eiskaffee hielten, beschrieben die Person mit kühleren Eigenschaften.
Ob warm oder kalt, trotz Facebook, Partnerbörsen, Xing und WhatsApp – es scheint, als fehle dem Menschen etwas Existenzielles, wenn er mit anderen nicht mehr gemeinsam trinken kann: Zu den häufigsten Motiven auf der Online-Plattform Instagram zählen die Fotos frisch servierter Cappuccinos.
Tags: