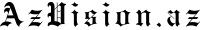Südafrika wächst. Nicht in die Breite, sondern in die Höhe. Millimeter um Millimeter hebt sich das Land, und das ausgerechnet in Zeiten, in denen Wasser knapp wird. Was zunächst nach einem geophysikalischen Rätsel klingt, könnte eine neue Möglichkeit zur Überwachung von Dürreperioden eröffnen.
Bereits seit einigen Jahren kann anhand von Satellitendaten festgestellt werden, dass Südafrika sich langsam anhebt. "Zwischen 2012 und 2020 zeigen diese Daten einen Anstieg von im Schnitt sechs Millimetern", erklärt Makan Karegar vom Institut für Geodäsie und Geoinformation der Universität Bonn laut einer Mitteilung. Doch was die genaue Ursache ist, war bislang unklar.
Eine Vermutung: Ein sogenannter Plume ist ein aufsteigender Strom heißen Materials aus dem tiefen Erdmantel, der in Form einer Säule in Richtung Erdoberfläche aufsteigt. Die aufsteigende Masse könnte die Erdkruste aufwölben und so die Höhenänderung verursachen. "Wir haben nun aber eine andere Hypothese getestet", sagt Karegar. Möglich sei nämlich auch, dass Verluste an Grund- und Oberflächenwasser für die Hebung verantwortlich sind.
Nach Dürren stärkere Anhebung
Karegar und seine Kollegen Christian Mielke, Helena Gerdener und Jürgen Kusche vom Institut für Geodäsie und Geoinformation wollten dieser Hypothese auf den Grund gehen. Sie untersuchten dafür unter anderem die regionalen Niederschlagsmuster in Südafrika. Dabei war etwas auffällig: Nach ausgeprägten Dürreperioden hoben sich die betroffenen Gebiete im Schnitt besonders stark.
Die Forschenden verglichen ihre Beobachtung mit Satellitendaten. Sie stellten fest: Je geringer die Masse des Wassers, desto höher der Anstieg, den die Messstationen in dem entsprechenden Planquadrat verzeichneten. Computermodellierungen zum Wasserkreislauf erhärteten die Hypothese. "Auch diese Daten belegen, dass sich der Anstieg vor allem durch Trockenheit und den damit verbundenen Verlust an Wassermasse erklären lässt", sagt Mielke. Ihre Studie erschien nun im "Journal of Geophysical Research".
Warnsignal für Wassermangel
Und so kann man sich das vorstellen: Wenn Landmassen austrocknen, beult sich die Erde an dieser Stelle aus, ähnlich wie ein Schaumstoffball, auf den zuvor Druck ausgeübt wurde. Dieser Effekt lässt sich nutzen, um das Ausmaß von Dürreperioden genauer als bislang zu erfassen - und das mit einer vergleichsweise günstigen und simplen Methode. Das ist deshalb interessant, weil ein großer Anteil der Wasserreserven unter der Erdoberfläche verborgen ist. Menschen zapfen dieses Grundwasser seit jeher mit Brunnen an - um es zu trinken, ihre Pflanzen zu bewässern oder auch, um es für industrielle Prozesse zu nutzen.
Mithilfe von stationären GPS-Empfängern lässt sich laut dem Forschungsteam also nachvollziehen, wie sehr diese unterirdischen Wasserreserven schon erschöpft sind. Im Bedarfsfall ließe sich die kostbare Ressource dann eventuell rechtzeitig rationieren, so die Forscher. Im Zuge des Klimawandels und der resultierenden veränderten Niederschlagsmuster dürfte dieses Problem in Zukunft noch gravierender werden.
Das zeigt sich übrigens ebenfalls am Beispiel Südafrikas: Dort kam es zwischen 2015 und 2019 zu einer verheerenden Dürre. Kapstadt drohte damals der "Day Zero" - ein Tag komplett ohne Wasser.
Quelle: ntv.de, kst
Tags: