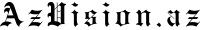Doch mit Zielen ist es so eine Sache. Schon lange hatte die Fachwelt auf Venters Mikrobe gewartet. Spätestens seit er 2010 die Erschaffung der ersten synthetischen Zelle veröffentlicht hatte. Die Nachricht sorgte damals für Schlagzeilen. Im Grunde handelte es sich um eine leicht abgewandelte Kopie des natürlichen Bakteriums Mycoplasma mycoides, ein Parasit, der Wiederkäuer befällt. Doch war es tatsächlich das erste Bakterium, dessen Erbgut vollständig am Computer entworfen und dann im Labor von Maschinen aus vier biochemischen Grundbausteinen zusammengesetzt worden war. Auf dem Weg zum Minimalorganismus musste "Syn 1.0" eigentlich nur noch verbessert und vor allem genetisch entrümpelt werden.
Das Leben vom Reißbrett war zunächst eine Totgeburt
Jeder Organismus schleppt in seinen Zellen Erbanlagen herum, die keine Funktion mehr haben. Dieser genetische Ballast hat sich im Lauf der Evolution angesammelt. Manche dieser Altlasten waren vielleicht einmal überlebenswichtig, wurden dann aber durch Mutationen unbrauchbar oder unter veränderten Lebensbedingungen nutzlos. Andere Gene sind zwar in der freien Wildbahn wichtig, aber nicht in der Petrischale im Labor. Viele vitale Funktionen einer Zelle werden zudem von mehreren Genen übernommen. Manche dieser Redundanzen sind wichtig, andere verzichtbar.
Doch sechs Jahre nach den Schlagzeilen um künstliches Leben aus Venters Labor ist klar, dass die Schrumpfung eines Genoms alles andere als einfach ist. Die Veröffentlichung in Science liest sich über Seiten auch als ein Dokument des Scheiterns, eine neue Erfahrung für den erfolgsverwöhnten Multimillionär Venter. So hatten die Forscher zunächst gedacht, ihr genetisches Wissen reiche aus, um ein kürzeres Erbgut einfach am Computer zu entwerfen.
Die moderne Biologie beschränkt sich schon lange nicht mehr darauf, die Natur zu beschreiben - manche Wissenschaftler haben inzwischen schon das Ziel, selbst Organismen mit neuen Eigenschaften herzustellen. Doch wer in die Abläufe des Lebens eingreift, muss die Grenzen seines Tuns sorgfältig abwägen.
Doch das Leben vom Reißbrett war eine Totgeburt. Also begannen die Forscher von vorne. In jahrelanger Kleinarbeit untersuchte Venters Team noch einmal, welche Gene von Syn 1.0 überflüssig erschienen und entwarfen mit diesen Erkenntnissen ein neues Erbgut. Sie teilten es in acht Segmente und kombinierten jedes davon mit sieben unbearbeiteten Abschnitten des Bakteriums. Tatsächlich überlebten die Zellen, die nur ein Segment des neuen Erbguts enthielten. Doch als die Forscher alle acht zusammenfügten, entstand erneut keine lebende Zelle. Offenbar gab es Gene, auf die das Bakterium nur dann verzichten konnte, wenn andere Gene vorhanden waren, um den Verlust auszugleichen.
Venter hofft auf einen Milliardenmarkt für synthetische Biologie
Nach weiteren Untersuchungen fügten die Forscher daher wieder 26 Gene ein. So entstand nach einigen hundert Fehlversuchen eine erste lebende Zelle mit verkleinertem Erbgut, Syn 2.0. In einem weiteren Schritt entfernten die Forscher dann noch einmal 42 Gene und gelangten so zu Syn 3.0. Von über 900 Mycoplasma-Genen blieben am Ende 473 übrig. Die Erbanlagen ordneten die Forscher zudem säuberlich nach ähnlichen Funktionen, das soll zukünftige Experimente mit den Mikroben einfacher machen. "Wir hätten die Zahl weiter drücken können", sagt Clyde Hutchison, der an der Entwicklung der Designermikrobe beteiligt war, "doch der Preis wäre ein langsameres Wachstum gewesen". Vor dem Hintergrund, dass diese Mikroben einmal wertvolle Substanzen für den Menschen produzieren sollen, war das für Venters Team keine Option.
Dass Venter trotz der Hindernisse an dem Projekt festhält, hat schließlich weniger mit Entdeckerdrang als mit dem möglichen kommerziellen Nutzen der Arbeit zu tun: Genetisch optimierte Einzeller, die durch ein paar Ergänzungen in ihrem Erbgut im Labor und in der Biotech-Industrie wie mikroskopische Roboter alles erledigen, was man ihnen per DNA-Code einprogrammiert. Wie in einem Baukastensystem mit Zusatzgenen ausgestattet könnten sie zum Beispiel Medikamente herstellen, Kunststoff oder andere Chemikalien wie Biosprit, und dabei gleich noch das Treibhausgas CO₂ aus der Atmosphäre holen. Oder sie verwandeln Umweltgifte in harmlose Stoffe. Craig Venter sieht einen Milliardenmarkt für synthetische Biologie heranwachsen. Um die Konkurrenz auf Abstand zu halten, hat er bereits 2007 Patentanträge für seine damals noch hypothetischen Minimalmikroben gestellt.
Tags: