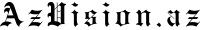Das zukünftige Rückgrat der europäischen Stromversorgung ist die Windenergie. Bis 2030 möchte die EU von Schweden bis nach Italien und von Portugal bis nach Rumänien Windkraftanlagen mit einer Kapazität von 425 Gigawatt bauen. Das entspricht ungefähr der Leistung von 425 Atomkraftwerken. Bis 2050 sollen an Land und auf See Turbinen mit einer Leistung von 1300 Gigawatt hochragen.
Doch über der Branche braut sich ein Sturm zusammen. Die europäische Windindustrie leidet seit der Corona-Pandemie unter steigenden Kosten und Lieferkettenproblemen. Mit Donald Trump sitzt zudem ein Politiker im Weißen Haus, der mit dem Zollhammer regiert und Windräder leidenschaftlich hasst. Die womöglich größte Gefahr lauert jedoch in Fernost: China schickt sich an, mit der Windkraft die nächste Zukunftsbranche zu dominieren.
Derzeit stehen in Europa Windräder mit einer Kapazität von 220 Gigawatt. Fast alle davon stammen aus den Händen der europäischen Pioniere Vestas, Siemens Gamesa, Nordex oder Enercon. Sie wurden jedoch errichtet, als die chinesische Konkurrenz noch keine Gefahr darstellte.
"In der Vergangenheit waren europäische Turbinen den chinesischen überlegen, deshalb gab es nur wenige Überschneidungen zwischen den beiden Märkten", erklärt Morningstar-Analyst Matthew Donen. "Aber chinesische Unternehmen wie Mingyang haben ihre Anlagen wirklich verbessert und können inzwischen mit europäischen mithalten."
Dammbruch in Italien und Deutschland
Einige europäische Projekte machen von diesen Optionen bereits Gebrauch. Der Dammbruch fand vor wenigen Jahren in Italien statt: Beleolico, der erste Windpark im Mittelmeer, wurde mit chinesischen Windrädern gebaut. Seit knapp drei Jahren versorgen zehn kleine 3-Megawatt-Anlagen von Mingyang 60.000 Menschen im italienischen Stiefelabsatz mit Windstrom "made in China".
Vergangenen Sommer fiel der zweite Dominostein in Deutschland. Das Waterkant-Projekt in der Nordsee entschied sich ebenfalls dafür, den Windpark mit Turbinen von Mingyang auszustatten. Bei Borkum sollen 16 riesige Anlagen mit einer Leistung von 18,5 Megawatt ins Wasser gestellt werden.
Es sollen nicht die letzten sein: "Dieses Projekt ist ein wichtiger Meilenstein, um in den europäischen Offshore-Windmarkt einzusteigen", prophezeite Mingyang, als es den Zuschlag für Beleolico erhielt. Für einen Windpark in der französischen Bretagne bewerben sich chinesische Hersteller inzwischen bereits mit einer ebenso neuen wie gigantischen 20-Megawatt-Turbine.
In der europäischen Windindustrie geht seitdem mal wieder die Angst um. Das Schreckensszenario ist der schleichende Niedergang einer Zukunftsbranche - ähnlich wie vor Jahren in der Solarindustrie: China ist bereits seit 2020 weltweit der größte Hersteller von Windrädern. Der europäische Anteil am globalen Windmarkt schrumpfte dagegen in den vergangenen Jahren von 42 auf 35 Prozent - auch weil Rohstoffpreise explodierten und europäische Hersteller die Kosten aufgrund von bestehenden Verträgen nicht an ihre Abnehmer weitergeben konnten. "Die Preise werden Jahre im Voraus vereinbart", erklärt Analyst Donen das Dilemma.
"Geht nicht ohne unfaire Unterstützung"
Die chinesischen Hersteller dagegen haben nicht nur technologisch zu den europäischen Pionieren aufgeschlossen. Sie bieten ihren Kunden großzügige Finanzierungsbedingungen wie jahrelange Zahlungsaufschübe an. Im Schnitt kosten chinesische Turbinen zudem 20 Prozent weniger als die europäische oder nordamerikanische Alternative. In manchen Fällen sollen sie sogar bis zu 50 Prozent günstiger sein - trotz der hohen Lieferkosten, die für den umständlichen Transport der riesigen Anlagen auf dem Seeweg fällig werden.
"Das geht nicht ohne unfaire öffentliche Unterstützung", sagt der europäische Branchenverband Windeurope. Die chinesische Windindustrie profitiere genauso wie die chinesische Solar- und E-Auto-Industrie von "extremen" Subventionen, sagt der Bundesverband Windenergie.
Zehntausende Arbeitsplätze in Gefahr
Subventionen hin oder her - aus Sicht der europäischen Energieversorgung sind günstige chinesische Windräder ebenso zu begrüßen wie günstige chinesische Solaranlagen, denn sie garantieren günstigeren Strom. Das ist auch aus Sicht des Klimaschutzes wertvoll. Doch die europäische Windindustrie ist nicht nur wichtiger Stromproduzent, sondern auch Arbeitgeber. Angeführt von Unternehmen wie Vestas oder der Siemens Gamesa beschäftigt die Branche inzwischen 300.000 Menschen. In den kommenden fünf Jahren soll sich die Zahl durch den großen Offshore-Ausbau verdreifachen.
In der Politik stoßen die Wettbewerbsbeschwerden der Branchenverbände und Unternehmen deshalb auf offene Ohren. Das Bundeswirtschaftsministerium kündigte vergangenes Jahr an, Chinas Rolle beim Waterkant-Windpark "sehr genau" zu prüfen, um sicherzustellen, dass "gleiche Wettbewerbsbedingungen aufrechterhalten werden". Die EU-Kommission hat ebenfalls eine Untersuchung gegen chinesische Lieferanten von Windkraftanlagen eingeleitet.
Das wiederum sieht Peking gar nicht gern. Europa müsse diese Untersuchungen stoppen, wenn es den Kampf gegen den Klimawandel und die Inflation ernst meine, erklärte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums.
Chinesische Fertigung in Italien und Schottland
Doch danach sieht es aktuell nicht aus. Im Gespräch sind Bauquoten, wie sie Christian Bruch vorschweben, dem Chef der Siemens-Gamesa-Mutter Siemens Energy. Der Net Zero Industry Act der EU-Kommission sieht vor, dass 40 Prozent sämtlicher grüner Technologien, die in Europa verbaut werden, auch in Europa hergestellt werden müssen. Für Windräder liegt die Zielmarke bis 2030 sogar bei 85 Prozent - auch aus Sicherheitsgründen: Europa möchte bei der Windkraft nicht von China abhängig werden.
Doch ob Quoten vor der chinesischen Konkurrenz schützen können, ist fraglich. Mingyang treibt bereits seit einiger Zeit Planungen für den Bau von Turbinenwerken in Italien und auch Schottland voran, die EU-Vorgaben für fairen Wettbewerb, aber auch europäische Sozial- und Umweltstandards erfüllen könnten.
Denn die Probleme der europäischen Windbranche sind zumindest in Teilen hausgemacht. Branchenverbände und Wirtschaftsinstitute kritisieren schleppende Genehmigungsverfahren. "Europaweit stecken etwa 80 Gigawatt an Windkraftprojekten in bürokratischen Verfahren fest", sagt Windeurope. Das sei einer der größten Engpässe für den schnellen Ausbau der Windenergie - und für die Planungssicherheit der europäischen Turbinenhersteller: Teilweise sollen sie sich bereits weigern, für neue Offshore-Projekte zu bieten. Zu diesem Schluss kommt die in der Branche tätige Beratungsfirma Watson, Farley & Williams.
Deutschland geht voran
Die Forderung? "Die meisten Regierungen wenden die EU-Genehmigungsregeln nicht an", kritisiert Windeurope. "Sie müssen hier dem Beispiel Deutschlands folgen." Denn hierzulande wurden im vergangenen Jahr rund 2400 neue Anlagen mit einer Gesamtleistung von etwa 14 Gigawatt neu zugelassen - ein neuer Rekord und 85 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor.
Wendepunkt für den deutschen Schub war die gesetzliche Festlegung, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien im "überwiegenden öffentlichen Interesse" ist und der öffentlichen Sicherheit dient. Das hat die Zahl der Einspruchmöglichkeiten deutlich reduziert. Im Durchschnitt dauert es etwas mehr als zwei Jahre, bis nach der Genehmigung ein Windrad errichtet wird und den ersten Strom ins Netz einspeist.
Aber auch die Projektvergabe hält der Branchenverband in vielen Fällen für marktfeindlich. Denn nach wie vor ist es in einigen EU-Ländern üblich, dass das Baurecht für einen Windpark meistbietend versteigert wird. Gleichzeitig werden die angesprochenen Fixpreise für Turbinen verlangt, die später nicht weitergegeben werden können - eine Kostenfalle für Projektentwickler und Windrad-Hersteller, die das Ende einer vielversprechenden Branche beschleunigen werden.
Quelle: ntv.de
Tags: